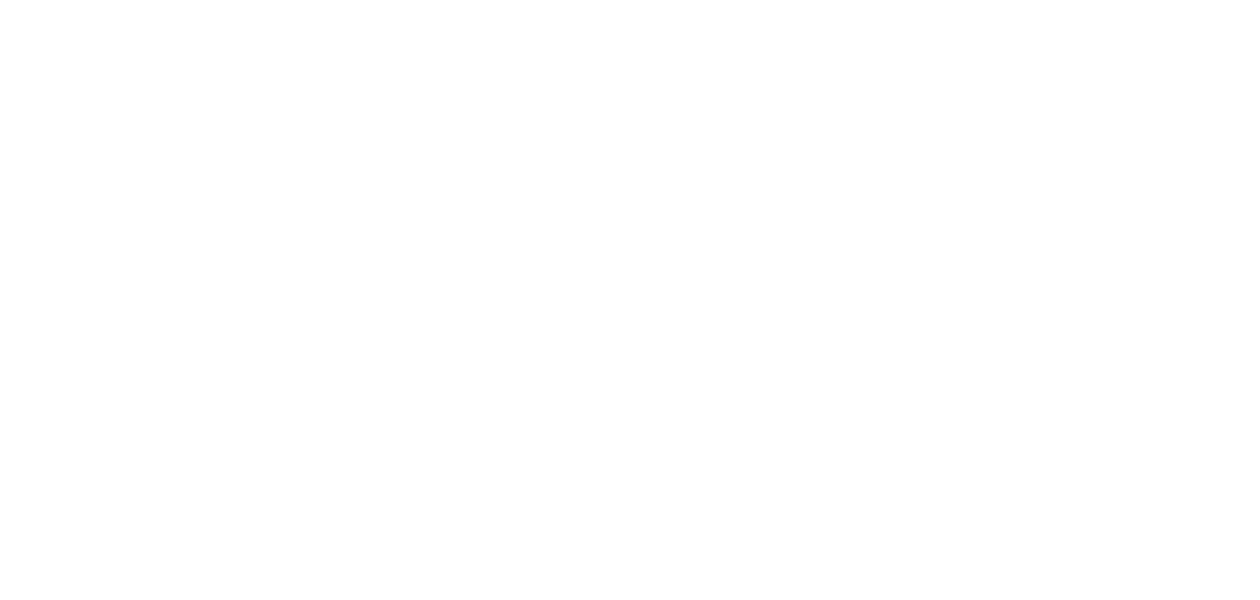Risiko Teil 2 – Vorsicht bei Fondsrisiken
Der Schock manches Anlegers sitzt tief, wenn er in der Krise die tiefroten Zahlen seines Fonds im Depot sieht. Der Fond, der sich doch in einer moderaten Risikostufe befand, hat plötzlich stärker nachgelassen, als erwartet. Im zweiten Teil der Artikelreihe schauen wir uns genauer an, wie das Risikorating für Fonds in die Irre leiten kann.
Die Risikoklasse
Fonds müssen in Europa nach einer einheitlichen Methode in einen Risikoklasse eingeteilt werden. Diese sogenannte SRRI-Methode (Synthetic Risk and Reward Indicator) unterteilt Fonds in Risikoklassen zwischen 1 und 7, abhängig von ihrer durchschnittlichen Schwankungsbreite (Volatilität) in den letzten fünf Jahren. Wenn ein Fond in den letzten fünf Jahren durchschnittliche nur fünf Prozent nach oben oder unten schwankte, so wird dieser in die Kategorie 4 von 7 eingestuft. Je höher die Kategorie, desto höher das Risiko, aber auch die Renditeerwartung. Diese SRRI Risikostufe wird dann in die Pflichtdokumente für den Fonds übernommen. Der klassische Finanzberater fragt den Anleger in einem Beratungsgespräch, ob er sich eher als „chancenorientiert“ oder „sicherheitsorientiert“ einschätzt und lässt diesen sich auf einer Skala von 1 bis 5 oder 1 bis 7 einordnen. Danach wählt der Berater Fonds aus, die der Risikostufe des Anlegers entsprechen.
Das Problem
Problematisch ist hier natürlich einerseits, dass der Anleger gar nicht genau weiß, was Kategorie 4 „moderat“ konkret bedeutet und zum Anderen das Vorgehen in der Fondsbewertung. Ersteres Problem lassen wir hier mal außen vor, da es weniger ein Problem des Risikomodells ist, sondern das schlechter Beratung. Das Problem der Fondsbewertung jedoch liegt darin, dass lediglich die Volatilität der letzten 5 Jahre betrachtet wird. Sollte in den letzten 5 Jahren der Kapitalmarkt jedoch keine größeren Krisen erlebt haben, wie es etwa in den fünf Jahren vor der Coronakrise der Fall war, so wiegt die Risikostufe in falsche Sicherheit. Entscheidend für den Anleger ist doch, wie sich der Fonds in Extremsituationen verhält. Ein Fonds der Kategorie 4, der in den letzten fünf Jahren maximal um fünf Prozent schwankte, kann in Krisenzeiten plötzlich mehr als 25 Prozent schwanken und damit in der höchsten Risikostufe landen. Dieses Problem potenziert sich noch, wenn es sich etwa um einen Themenfond handelt, der in eine Branche investiert, die besonders durch eine Krise betroffen ist (etwa die Flug-und Tourismusbranche in der Coronakrise).
Die Lösung
Wer ein bitteres Erwachen in der Krise vermeiden will, der sollte schauen, wie sich der Fond in der letzten Krise geschlagen hat. Die Risikokennzahl des Maximum Drawdowns gibt an, wie viel Prozent der Fond maximal insgesamt verloren hat und eignet sich daher besser als Risikomaß. Zu achten ist jedoch auch hier darauf, ob der Fonds bereits eine Krise überstanden hat und ein maximum Drawdown für eine Krisenzeit vorhanden ist. Vorsicht ist grundsätzlich auch bei klassischen Fonds gefordert, da ein Fondsmanager über die Zeit den Schwerpunkt und die Gewichtung in einem Fonds so ändern kann, dass die Aussagekraft des letzten Maximum Drawdowns nur noch gering ist. Transparenter sind hier Indexfonds mit einer möglichst breiten Streuung.
Kernaussage
Die Risikoeinstufung von Fonds nach der gesetzlich geforderten SRRI Methode ist nur begrenzt aussagefähig. Der Maximum Drawdown eines Fonds in einer Krisenphase ist eine Kennzahl, die besser dazu geeignet ist das Risiko zu visualisieren.
Sebastian Paß
Weitere Beiträge des Autors